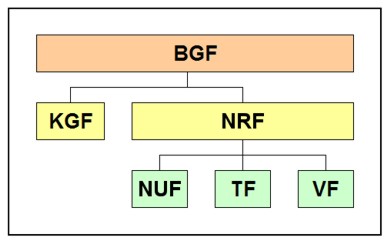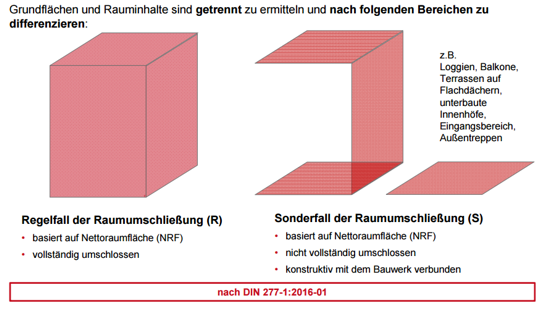|
x |
|
x |
|
|
|
Bautechnische Berechnungen / Nachweise |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Bearb-Stand:
Juli 2011 |
|
die Kapitel hier sind:
-
Bautechnischer Brandschutz
- Sachverhalte zum WärmeSchutz / EnEV
- FeuchteBilanz-Berechnungen nach DIN 4108
- Bautechnischer Schallschutz
-
weitere
Schutz-Bereiche am Bau
- x
-
Flächen-
und Volumen-Berechnungen am Bau
-
statische Berechnungen
- x
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
 BrandSchutz BrandSchutz |
|
|
|
|
|
|
|
 Grundlagen
- das
Brandschutz-Konzept Grundlagen
- das
Brandschutz-Konzept
ganzheitliches Brandschutz-Konzept >

- Baulicher BrandSchutz > Tätigkeitsfeld von BauPlanung +
BauDurchführung
- Abwehrender Brandschutz > das ist dann der Part der Feuerwehr
> Brandschutz-Konzept zur Thematik KühlraumBau s.
hier
- der bauliche Brandschutz muss folgende Aspekte berücksichtigen;
1. Brandverhalten von
Baustoffen
2. Feuerwiderstand der
Bauteile
3. Aufteilung der Gebäude in
Brandabschnitte durch Brandwände und -schutztüren
4. Fluchtwege-Planung
5. aktive Brandbekämpfung
u.a.
durch Sprinkleranlagen
|
|
|
|
 Vorschriften
und Richtlinien Vorschriften
und Richtlinien
- BauOrdnungsrecht, Strafrecht, Zivilrecht
- Hierarchie > Bauordnung, Verwaltungsvorschriften, Richtlinien, Normen
 2
grundsätzliche BemessungsGrundlagen; 2
grundsätzliche BemessungsGrundlagen;
1. LBO > Angaben zur BauGestaltung /bauseitigen
DurchBildung
> auf dieser Grundlage wird der BrandSchutz pauschal abgehandelt, will
sagen es gibt hier keine vorgegeben-abzu-spulende NachweisFührung,
wichtig ist nur, dass alle relevanten brandschutz-technischen Sachverhalte
erfasst werden
> HauptBezug ist dann hier die DIN 4102
2. Brandschutz für Industriebauten nach IndBauRL in Verbindung
mit der DIN 18230 Baulicher BrandSchutz im Industriebau - Brandlastberechnung
> diese IndBauRL in Verbindung mit der DIN 18230 liefert quasi einen
"Fahrplan" für eine einheitliche bradschutz-technische Bemessung
/einen
in sich abgeschlossenen BrandSchutz-Nachweis
> für GewerbeBauten gilt diese DIN also parallel zur LBO
bzw IndustrieBauten, die den Anforderungen dieser Richtlinie entsprechen,
erfüllen die SchutzZiele des § 15 Abs. 1 LBO
> der Vorteil bei diesem NachweisVerfahren, es kann
Erleichterungen gegenüber der NachweisFührung nach LBO geben, u.a.
deshalb, da hier weniger mit pauschalen Annahmen gearbeitet wird
 MusterRichtlinien
(vordergründig zu Brandschutz-Lösungen) MusterRichtlinien
(vordergründig zu Brandschutz-Lösungen)
-
MBO 2002 > MusterBauOrdnung
-
MLAR 2005
> Muster-LeitungsAnlagen-Richtline MLAR 2005 /nur Text
>
farbige BildGrafiken vom Missel-Professor + Text
-
MLüAR 2005 > Muster-Lüftungsanlagen-Richtlinie M-LüAR
>
farbige BildGrafiken vom Missel-Professor + Text
-
MSysBöR 2005 > Muster-Systemböden-Richtlinie
> farbige BildGrafiken vom Missel-Professor + Text
- MEltBauVO > Muster-Verordnung zum Bau von Betriebsräumen von
elektrischen Anlagen
-
MFeuVO > FeuerungsVerordnung
-
MVStättV 2005 > Musterverordnung über den Bau und Betrieb von
Versammlungsstätten
-
MHHR 2008 > Muster-Richtlinie über den Bau und Betrieb von
Hochhäusern
|
|
|
|
 Baurechtliche
Zuordnung von Gebäuden Baurechtliche
Zuordnung von Gebäuden
- geregelt in der BO § 2 GebäudeKlassen
1. Abhängigkeit von Nutzung
2. Abhängigkeit von Höhenentwicklung
- NutzungsRegime >
Ansammlung von Menschen, Lagerung explosionsgefährdeter Güter
etc
- BrandSchutz im Bestand >
Juristische Anforderungen an das Bauen und den Brandschutz im Bestand
>
Instandsetzungsmaßnahmen bei Wohngebäuden
- BrandSchutz und GewerbeBau >
PorenBeton-Studie
|
|
|
|
 Erschließung,
Zufahrtswege,
Zugänge und Bewegungsflächen für die Feuerwehr Erschließung,
Zufahrtswege,
Zugänge und Bewegungsflächen für die Feuerwehr
- BO § 5 Zugänge und Zufahrten auf den Grundstücken
> Notwendigkeit
> Forderungen
> Lösungen
|
|
|
|
- BrandVerhinderung / GegenStrategien durch
Entscheidungen bei der GebäudePlanung
 Brandabschnitte Brandabschnitte
hier sind folgende Sachverhalte von Bedeutung;
1. Abgrenzung baulicher Anlagen gegenüber Nachbargrundstück
2.
Unterleitung großer Gebäude
3. Eingeschossige und mehrgeschossige Gebäude
4. Brandwände
5. Wände anstelle von Brandwänden
6. KomplexTrennwände
> KomplexTrennwand + BrandWand im BildVergleich
7. Decken
8. Ausbildung in Grenzbereichen
9. Öffnungen und Durchbrüche in BrandschutzKonstruktionen
>
Brandschutz-BauteilLösungen zur Thematik KühlraumBau s.
hier
- PowerPoint-Bearbeitungen zum Thema Brandabschnitt >
BildGrafiken mit TextBeschrieb 01
- Google-Suche >
Bilder zu Brandwänden
Abschottungen (Schott's)
- AbschottngsPrinzipien
-
Durchdringungen und Abschlüsse
>
umfangreiche DetailDarstellung von Brandschutz-BauteilLösungen zur Thematik KühlraumBau s.
hier
haustechnische BrandBekämpfung
-
BrandMelde-Anlagen
- Rauch- und WärmeAbzugs-Anlagen
-
Lösch-Anlagen > WasserLösch- GasLösch-
Sauerstoffreduzierungs-Anlagen
|
|
|
|
 Rettungswege Rettungswege
hier sind folgende Sachverhalte von Bedeutung;
1.
Erster und zweiter Rettungsweg (= EvakuierungsWeg)
> BO § 33 Erster und zweiter Rettungsweg
/weiter die §§ 34 bis 38
>
Beschilderung, RettungsPläne
2. Lage und Abmessungen der Rettungswege
3. Räumungszeit
4. Gänge, Flure, Balkone, Treppen, Treppenräume, Aufzüge, Rampen, Schleusen,
Tunnel
|
|
|
|
 Brandverhalten
von Baustoffen und Bauteilen Brandverhalten
von Baustoffen und Bauteilen
hier sind folgende Sachverhalte von Bedeutung;
1. Begriffe: Baustoff <-> Bauteil
brennbar <-> nichtbrennbar
feuerhemmend <-> feuerbeständig
>
Feuerwiderstand
2.
Baustoffklasse
3. Erläuterung DIN 4102 Teil 1 bis Teil 18
4. Kennzeichnung von Baustoffen und Bauteilen >
CE-Kennzeichnung
5.
BauRegelliste
|
|
|
|
- Zuordnung von Begriffen zwischen BauOrdnung §§ 28-32 und DIN 4102
> Bauaufsichtliche Benennungen
> sind Bezeichnungen aus der BauOrdnung
|
|
|
|
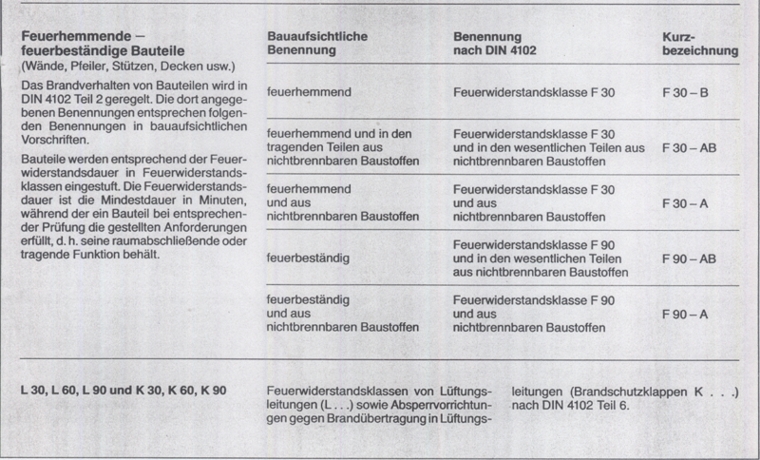
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 Anforderungen
an Baustoffe und Bauteile Anforderungen
an Baustoffe und Bauteile
nach DIN 4102 Teil 4 sind folgende Bauteile brandschutzseitig
von Bedeutung;
1. Tragende Wände
2. Trennwände
3. Außenwände
4. Dach
5. Decken, Unterdecken
6. Türen, Tore, Luken
7. Fenster
- DIN 4102
Brandverhalten von
Baustoffen und Bauteilen
> diese DIN 4102 besteht aus vielen einzelnen Teilen und beinhaltet brandschutztechnische Forderungen und Regelungen
für den Einsatz und die Verarbeitung von Baustoffen, Bauteilen
> PowerPoint-Vorstellung der
DIN 4102 in allen ihren Teilen
- parallele Darstellung
von DIN-Sachverhalten sind z.T. in der BO Abschnitt 4: Wände,
Decken, Dächer §§ 28 bis 32
- ausgewählte
ProduktenHersteller für klassifizierte Brandschutz-Baustoffe/Bauteile
> es geht hier darum, dass speziell zur Erfüllung von BrandschutzForderungen
geeignete DetailLsgen angeboten werden;
-
PROMAT >
für alle Bauteile (> Stahl etc)
-
KNAUF > für TrockenBau-Lsgen
- PorenBeton
> für MassivBau-Lsgen
|
|
|
|
 Brandschutznachweis/Brandschutzkonzept Brandschutznachweis/Brandschutzkonzept
- Etappen der BrandschutzNachweis- /BrandschutzKonzept-Bearbeitung
> Notwendigkeit im Rahmen der Vorplanung
> Notwendigkeit im Rahmen der Genehmigungsplanung
- Inhalt/Gliederung
>
Hinweise zur Erstellung von Brandschutzkonzepten und Brandschutznachweisen
- Einschalten von Sachverständigen
> 1. Stufe = Zertifikat als Fachplaner für vorbeugenden BrandSchutz
> 2.
Stufe = Zertifikat als Sachverständiger für vorbeugenden BrandSchutz
- BrandSchutz bei der
BauAusführung
- der
Brandschutz-Atlas (B-Atlas) ist das wohl umfangreichste + kompetenteste Werk zum
baulichen Brandschutz und sichern DeteilAusbildungen
wer
diesen Brandschutz-Atlas noch nicht kennt, es handelt sich hier durchweg um
farbig-grafisch sehr anschaulich gestaltete Details mit Erklärungs-Beschrieb
- Link zum
Brandschutz-Forum
> dieses Forum ist dem Brandschutz-Atlas angeschlossen
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 BrandschutzNachweis
WGH
Mütze BrandschutzNachweis
WGH
Mütze |
|
|
|
|
|
|
|
- der BrandschutzNachweis erfolgte auf Basis der SächsBO in
Verbindung mit den Teilen der DIN 4102
- nach SächsBO § 30 (1)
erfüllen die HolzBalken-Decken über EG und 1.OG die Forderungen nach
F90-AB nicht
> zu diesem TatBestand abschliessend die Stellungnahme des
PrüfStatikers für dieses Objekt
- alle anderen SchutzZiele (BrandSchutz)
nach der SächsBO konnten schon planungsseitig erfüllt werden
|
|
|
|
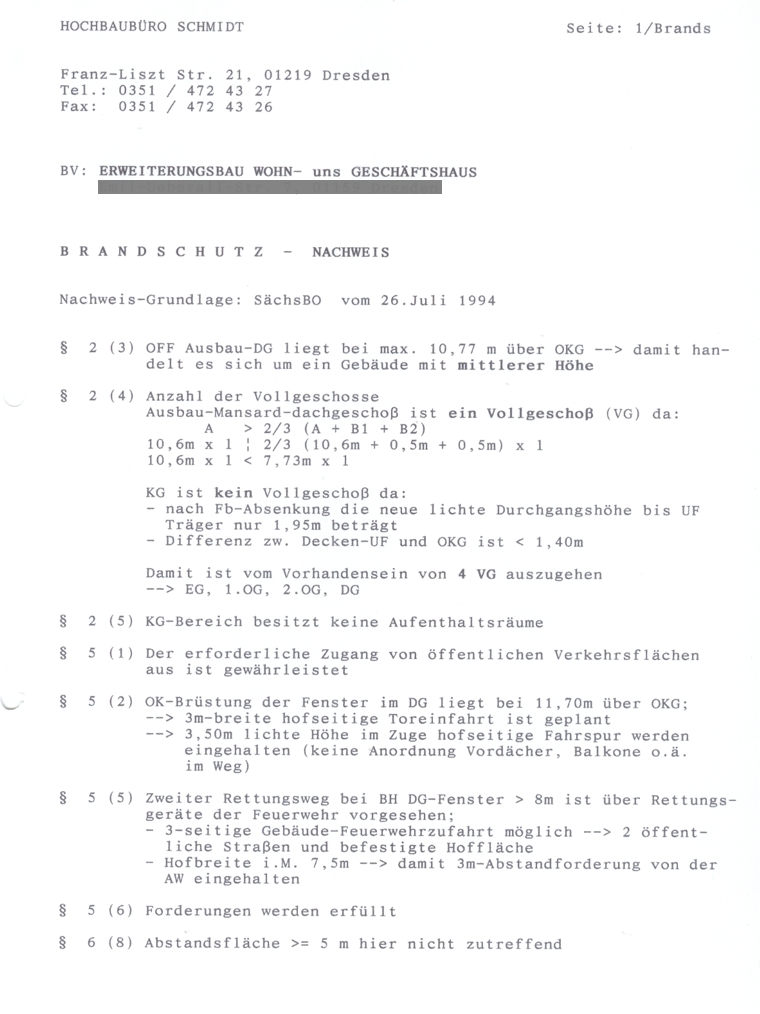 |
|
|
|
|
|
|
|
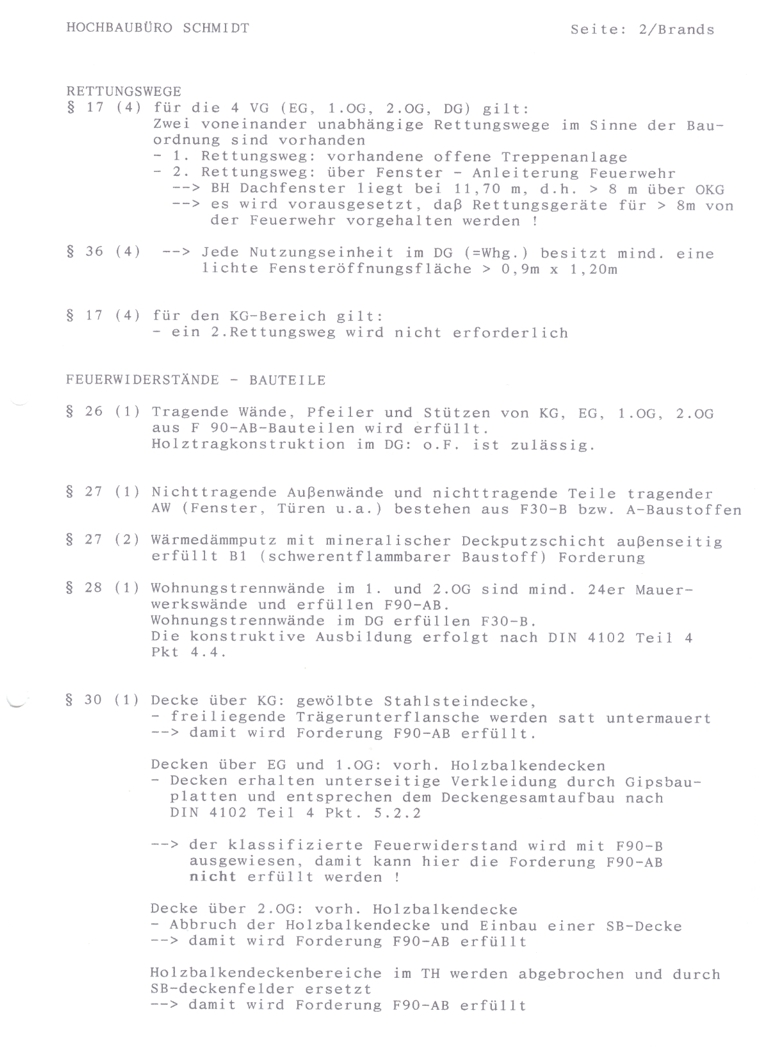 |
|
|
|
|
|
|
|
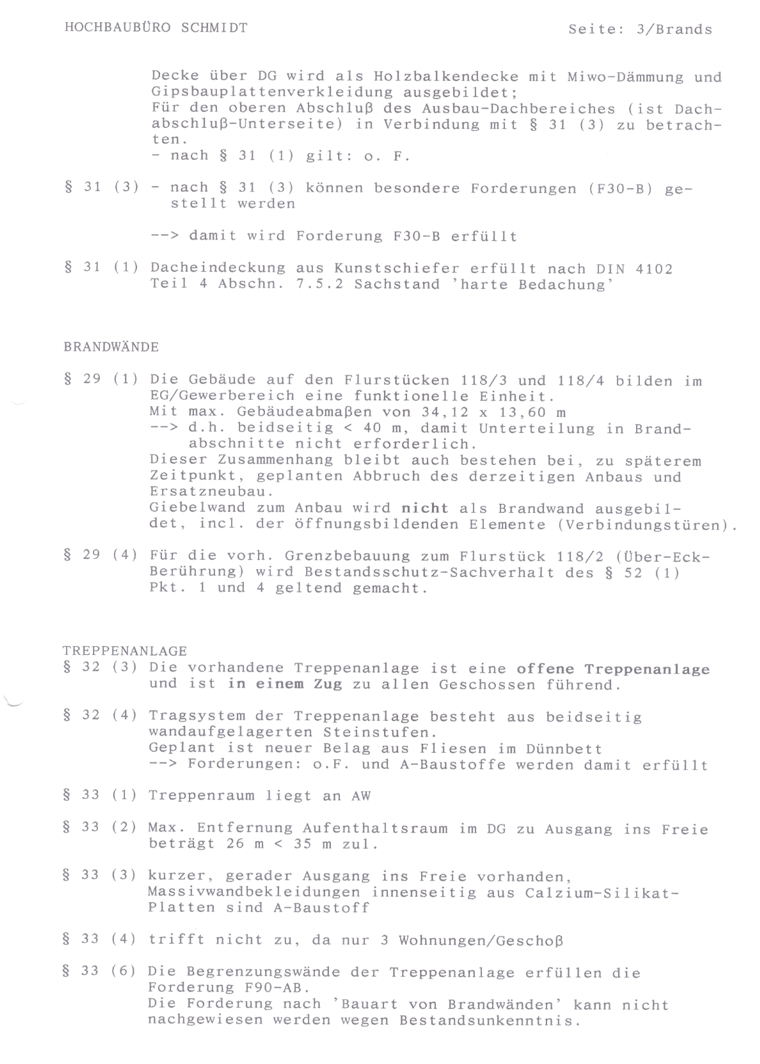 |
|
|
|
|
|
|
|
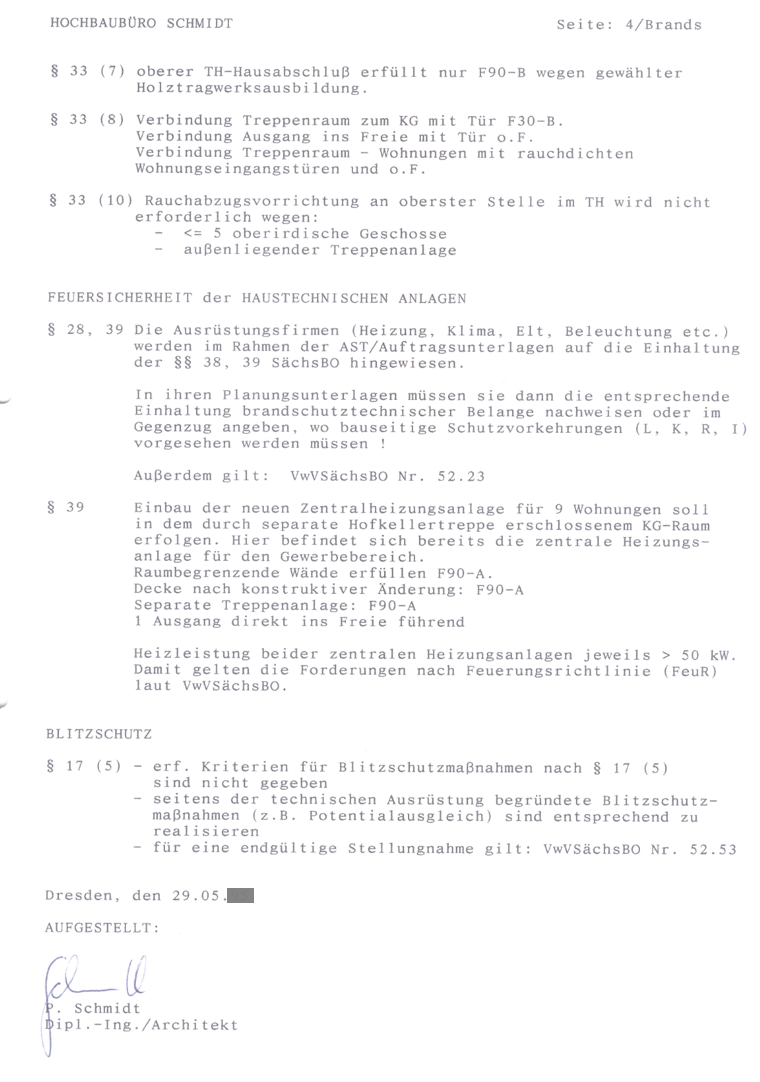 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Auszug (Abschnitt von S. 6) aus der Stellungnahme des PrüfStatikers für
dieses Objekt;
|
|
|
|
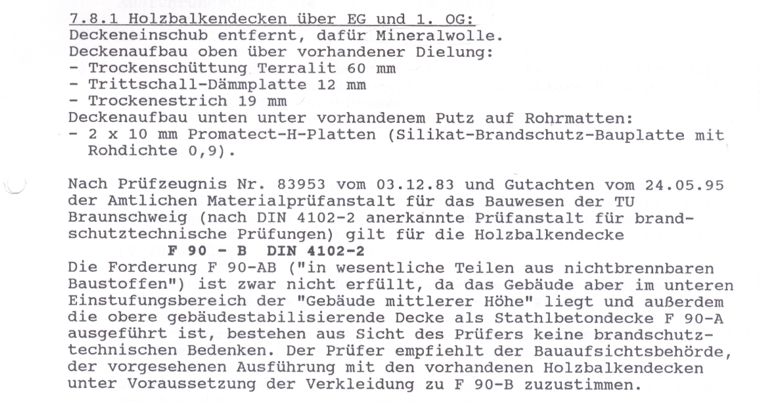 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
 WärmeSchutz WärmeSchutz |
|
|
|
|
|
|
|
 Sachverhalte zum WärmeSchutz
Sachverhalte zum WärmeSchutz |
|
|
|
|
|
|
|
- der
WärmeSchutz-Nachweis ist heute Bestandteil des EnEV-Nachweises
> er ist für Wohn- und NichtWohn-Gebäude zu führen
 in
Verbindung mit dem Wärmeschutz können noch andere Berechnungen
erforderlich /sinnvoll sein; in
Verbindung mit dem Wärmeschutz können noch andere Berechnungen
erforderlich /sinnvoll sein;
- KälteSchutz-Nachweis für Kühl-
und GefrierLager-Räume bzw -Bauten > s. unter
KälteSchutz
- WärmeAbleitung von Fussböden
-
TemperaturAmplitudendämpfung
/Wärmebeharrung >
sommerlicher "Kälte"-Schutz
-
FeuchteBilanzen > DampfdiffusionsBerechnungen >
Nachweis der Tauwasserfreiheit von Oberflächen
>
DampfdiffusionsBerechnungen werden immer nur für ein EinzelBauteil
geführt > Glaser-Diagramme
- Nachweis das Wärmeschutzes
nach DIN 4108 für SonderBauwerke /Bauten, die nicht unter die
EnEV fallen, wo es darum geht ein bestimmtes niedriges TemperaturNivau
zu stabilisieren zB landwirtschaftlich-genutzte Gebäude, Zoo-Bauten
-
U-Wert und Wärmeschutz-Berechnung und >
Die Berechnung des U-Wertes
- U-Wert-Rechner > damit lässt sich eine BauteilKonstruktion
berechnen
http://www.u-wert.net/berechnung/u-wert-rechner /
- Fenster k-Werte > U-Werte
> verbundene Problematik RolladenKasten
 älteres
Vorschriftenwerk älteres
Vorschriftenwerk
- WSVO
>
WärmeSchutz-Nachweise nach WSVO umfassen das GesamtGebäude
a) HüllflächenVerfahren
oder
b) BauteilMethode
>
der Gesamt-Nachweis erfolgt dabei nach der WSVO als der
aktuellen Vorschrift für derartige Nachweisführungen
> die eigentlichen Berechnungen /RechenFormeln, StoffKennwerte etc beziehen sich aber
nach-wie-vor auf die DIN 4108-Grundlagen
>
jegliche DampfdiffusionsBerechnzngen sind nicht Bestandteil der
WSVO
-
TGL + DIN-Rechenwerte in vergleichender nebeneinander oder hinternander
TabellenForm > s.
hier
 Aspekt DenkmalPflege Aspekt DenkmalPflege
Konrad Fischer /Hochstadt a. Main
http://www.konrad-fischer-info.de/7d410831.htm > Zu den Risiken
der Dämmung und Dichtung gem. Energieeinsparverordnung EnEV (früher
Wärmeschutzverordnung WSVO)
 Stichworte für markante Sachverhalte zum WärmeSchutz Stichworte für markante Sachverhalte zum WärmeSchutz
-
THERMOGRAFIE
> WärmeAbstrahlung > findet
schlecht wärme-gedämmte Gebäudeteile
> vielfältige EinsatzMöglichkeiten
am Gebäude s.
hier
- LuftDichtheit >
Blower-Door-Test (Differenzdruck-Messverfahren)
>
Luftströmungen > findet schlecht winddicht-gemachte Gebäudeteile
/Bereiche wo KaltLuft ins Gebäude einfällt
-
hinterlüftete Fassade >
BildBeispiele
-
WÄRMEBRÜCKEN
>
BildBeispiele
> Aufzählung der
WärmeBrücken am Gebäude
> PowerPoint
Vortrags-Doku
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 das Vorschriftenwerk - DIN 4108
das Vorschriftenwerk - DIN 4108 |
|
|
|
|
|
|
|
zur Historie
- der StandartKomplex der DIN 4108 zielte ab auf
Sicherung eines hygienischen RaumKlimas im Winter und Schutz der
BauKonstruktion vor FeuchteSchäden
> unter diesem Gesichtspunkt wurde die DIN 4108 in den zwanzieger Jahren
geschaffen
- die DIN 4108 wurde abgelöst durch Nachweisführungen nach WSVO (WärmeSchutzVerordnung) (davon
gab es 3 Stück)
> damit sollte, bezogen auf das Gebäude ein energie-optimalerer
BaustoffEinsatz erreicht werden, daneben gab es Ansätze die
HeizTechnik mit zu erfassen
-
heute gilt:
der wirtschaftliche WärmeSchutz wird durch die EnEV (EnergieEinsparVerordnung) vorgegeben
> aktuell ist jetzt EnEV 2009
> hier wird nun versucht alles was im Rahmen einer Immobilie mit
EnergieVerbrauch zusammenhängt in den Nachweis mit einzubeziehen
(zB HausTechnik, AlternativEnergie-Nutzung etc)
-
die BerechnungsVerfahren zum baulichen Teil (StoffKennwerte und
RechenRegeln) für die Nachweise nach EnEV beruhen aber noch auf
dem DIN 4108-System, was dafür ständig novelliert wird
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 DIN 4108 (Aug. 1981) und TGL 35424 in
Gegenüberstellung
DIN 4108 (Aug. 1981) und TGL 35424 in
Gegenüberstellung |
|
|
|
|
|
|
|
 auf TGL 35 424 und darauf aufbauend der RiLi KüBau
basieren i.d.R. meine RechenBeispiele zum KüBau auf TGL 35 424 und darauf aufbauend der RiLi KüBau
basieren i.d.R. meine RechenBeispiele zum KüBau
> mit der folgenden Gegenüberstellung will ich
vermitteln, dass TGL und DIN in Bezug auf StoffKennwerte und
RechenVerfahren wegen ihrer gemeinsamen Quellen sehr nahe beieinander liegen
 die einzelnen Blätter der DIN 4108 Teil 1 bis 5
von August 1981 die einzelnen Blätter der DIN 4108 Teil 1 bis 5
von August 1981
DIN 4108 Teil 1 - Grössen und Einheiten /Aug.
81
DIN 4108 Teil 2 - WärmeDämmung und WärmeSpeicherung; Anforderungen und
Hinweise für Planung und Ausführung /Aug. 81
DIN 4108 Teil 3 - Klimabedingter FeuchteSchutz; Anforderungen und
Hinweise für Planung und Ausführung /Aug. 81
> hier sind noch keine BerechnungsVerfahren >
diese sind in Teil 5 unter Abschn. 11
DIN 4108 Teil 4 - Wärme- und feuchtetechnische Kennwerte
/Dez. 85
DIN 4108 Teil 5 - BerechnungsVerfahren /Aug.
81
> Teil 5 Abschn. 11 - DiffusionsBerechnungen > gilt zur Berechnung der TauwasserFreiheit
 dazu die
TGL 35 424-Gliederung > die 7 TGL-BeiBlätter
mit dem letzten aktuellen Stand dazu die
TGL 35 424-Gliederung > die 7 TGL-BeiBlätter
mit dem letzten aktuellen Stand
TGL 35424/01 - Allgemeine Forderungen /Nov. 87
TGL 35424/02 - Grössen, Einheiten, Kennwerte /Dez.
85
TGL 35424/03 - WärmeSchutz in der kalten JahresZeit /Sept. 86
TGL 35424/04 - WärmeSchutz in der warmen JahresZeit /April
81
TGL 35424/05 - FeuchtigkeitsBilanz für BauwerksTeile /März
81 (Enwurf Jan. 88)
> gilt zur Berechnung der TauwasserFreiheit
TGL 35424/06 - WärmeAbleitung von Fussböden /Febr. 87
TGL 35424/07 - Wirtschaftlicher WärmeSchutz /April
81
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 Gegenüberstellung
der Bezeichnungen von DIN 4108 und TGL 35424 Gegenüberstellung
der Bezeichnungen von DIN 4108 und TGL 35424
> verglichen werden nahezu zeitgleiche Ausgaben der StandartKomplexe
DIN 4108 und TGL 35424
> gleichermassen identisch sind dann auch die RechenRegeln die zT. mit den
Bezeichnungen verbunden sind
|
|
|
|
|
|
|
|
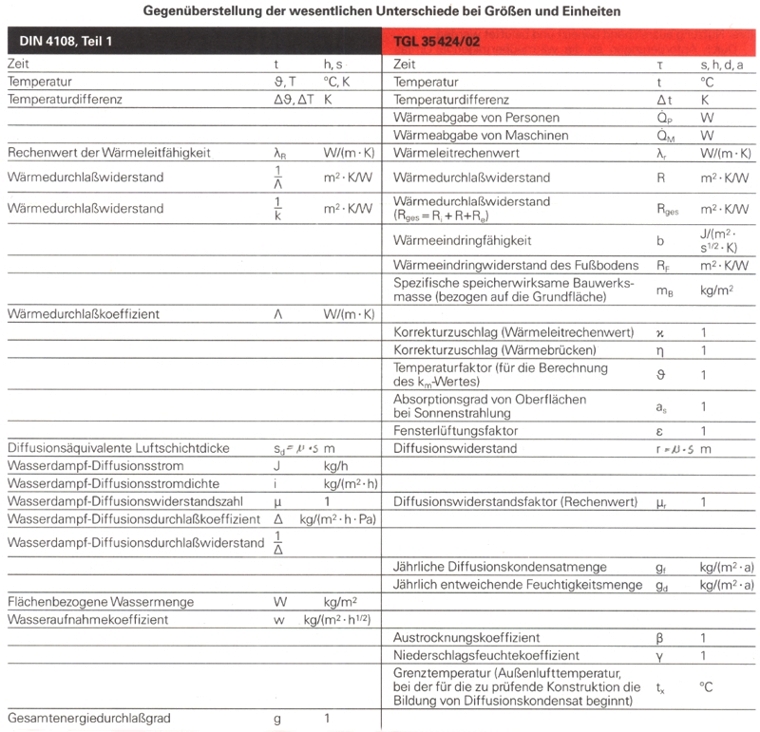 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 DIN 4108 - aktuelle Fassung
DIN 4108 - aktuelle Fassung |
|
|
|
|
|
|
|
 die DIN 4108 Wärmeschutz im Hochbau besteht
aktuell (vom Beuth-Verlag per 2010-01-06 angezeigt) aus folgenden Teilen: die DIN 4108 Wärmeschutz im Hochbau besteht
aktuell (vom Beuth-Verlag per 2010-01-06 angezeigt) aus folgenden Teilen:
DIN 4108-1 von 1981-08
Wärmeschutz im Hochbau; Größen und Einheiten
DIN 4108-2 von 2003-07
Wärmeschutz und Energie-Einsparung in Gebäuden - Teil 2:
Mindestanforderungen an den Wärmeschutz
DIN 4108-3
von 2001-07
Wärmeschutz und Energie-Einsparung in Gebäuden - Teil 3: Klimabedingter
Feuchteschutz; Anforderungen, Berechnungsverfahren und Hinweise für Planung
und Ausführung
> Anhang VI: Auszüge aus DIN 4108-3 > Hilfsmittel und
Tabellen zu Diffusionsberechnungen
> die DIN 4108 Teil 5 Abschn. 11 - DiffusionsBerechnungen gibt es
damit nicht mehr
DIN 4108-3 - Berichtigung 1
von 2002-04
Berichtigungen zu DIN 4108-3:2001-07
DIN V 4108-4
von 2007-06
Wärmeschutz und Energie-Einsparung in Gebäuden - Teil 4: Wärme- und
feuchteschutztechnische Bemessungswerte
DIN V 4108-6
von 2003-06
Wärmeschutz und Energie-Einsparung in Gebäuden - Teil 6: Berechnung des
Jahresheizwärme- und des Jahresheizenergiebedarfs
DIN V 4108-6 Berichtigung 1
von 2004-03
Berichtigungen zu DIN V 4108-6:2003-06
DIN 4108-7
von 2001-08
Wärmeschutz und Energie-Einsparung in Gebäuden - Teil 7: Luftdichtheit von
Gebäuden, Anforderungen, Planungs- und Ausführungsempfehlungen sowie
-beispiele
DIN 4108-7
Norm-Entwurf von 2009-01
Wärmeschutz und Energie-Einsparung in Gebäuden - Teil 7: Luftdichtheit von
Gebäuden, Anforderungen, Planungs- und Ausführungsempfehlungen sowie
-beispiele
DIN 4108-10
von 2008-06
Wärmeschutz und Energie-Einsparung in Gebäuden - Teil 10: Anwendungsbezogene
Anforderungen an Wärmedämmstoffe - Werkmäßig hergestellte Wärmedämmstoffe
DIN 4108 Beiblatt 1
von 1982-04
Wärmeschutz im Hochbau; Inhaltsverzeichnisse; Stichwortverzeichnis
DIN 4108 Beiblatt 2
von 2006-03
Wärmeschutz und Energie-Einsparung in Gebäuden - Wärmebrücken - Planungs-
und Ausführungsbeispiele
Literatur: Wärmeschutz und Energieeinsparung in Gebäuden
2004, Beuth Praxis
Wärmeschutz und Energieeinsparung in Gebäuden - Berechnung des
Jahresheizwärme- und des Jahresheizenergiebedarfs - Kommentar zu DIN V
4108-6:2003-06
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 Änderungen an
den verwendeten Bezeichnungen Änderungen an
den verwendeten Bezeichnungen
> seit 01. 02. 2002 ersetzt die EnEV (EnEV 2002) die bis dahin
geltende WSVO von 1995.
> mit dieser EnEV wurden nun auch jahrzehntelang geltende Begriffe im
bautechnischen WärmeSchutz verändert /umbenannt
> dazu die folgende tabellarische
Gegenüberstellung geänderter Begriffe + Indizes:
|
|
|
|
|
|
|
|
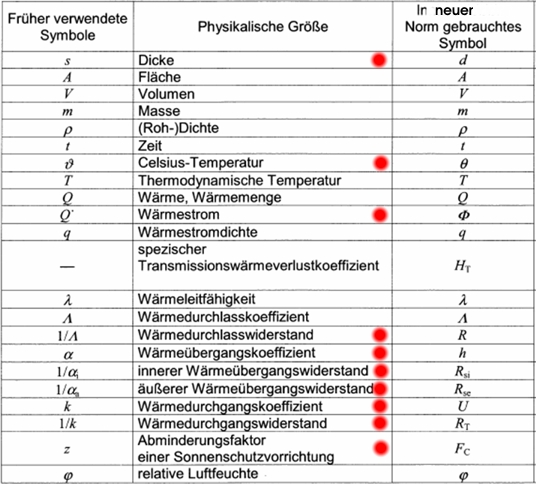 ) ) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 III.WSVO (April 1995)
III.WSVO (April 1995) |
|
|
|
|
|
|
|
 die
insgesamt 3 WSVO und ihre Inhalte; die
insgesamt 3 WSVO und ihre Inhalte;
1. WärmeSchutzV > ab 1978
> Vorgabe gesonderter k-ZielWerte
abhängig von der GebäudeNutzung
2. WärmeSchutzV > ab 1984
> gänzlich neue RechenVerfahren > HüllFlächen-Verfahren oder
BauteilMethode und Einführung WärmeBedarfsAusweis
3. WärmeSchutzV > ab 1995
> III.WSVO vom 01.01.95 >
strengere ZielWert-Vorgaben
wie ist das Vorgehen ? (statt EnEV wo es noch
umfangreicher wird beschreibe ich hier mal den Weg nach 2.WSVO)
NachweisVerfahren für den WärmeSchutz nach II. WSVO
(schematisch)
1. den Dammstoff auswählen mit
Dicken-Vorgabe für die Dämmstoff-BauteilSchicht
2. für das gesamte Bauteil den WärmedurchlassWiederstand berechnen >
Rges, vorh
3. für das gesamte Bauteil den äusseren + inneren WärmeübergangsWiederstand aus
Tabelle ermitteln
4. für das gesamte Bauteil den k-Wert berechnen
> k
> jetzt entscheiden, weiter mit >
HÜLLFLÄCHENVERFAHREN oder
BAUTEILMETHODE
ab hier >
HÜLLFLÄCHENVERFAHREN
5. k-Wert für das GesamtGebäude ermitteln und dazu die
GebäudeFlächen mit einbeziehen > km
6. den für das GesamtGebäude maximal zulässigen k-Wert über Formel berechnen
> km, max
7. km <= km, max
oder >
BAUTEILMETHODE
5. den k-Wert für das GesamtBauteil ermitteln und dazu
die BauteilFlächen mit einbeziehen > zB km, W+F
> das GesamtBauteil besteht hier aus den EinzelBauteilen zB
AW-DunkelFläche + Fenster
6. den für das GesamtBauteil maximal zulässigen k-Wert über Formel berechnen
> km, W+F max
7. km, W+F <= km, W+F max
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 fremde
WärmeSchutz-Berechnungen nach EnEV / DIN 4108 fremde
WärmeSchutz-Berechnungen nach EnEV / DIN 4108 |
|
|
|
|
|
|
|
 hier sind Verlinkungen zu
Berechnungs-Beispielen die unter Verwendung der neuen
Indizes geführt wurden hier sind Verlinkungen zu
Berechnungs-Beispielen die unter Verwendung der neuen
Indizes geführt wurden
der Gesamt-Nachweis erfolgt dabei nach der EnEV als der
aktuellen Vorschrift für derartige Nachweisführungen
> die eigentlichen Berechnungen /RechenFormeln, StoffKennwerte etc beziehen sich aber
nach-wie-vor auf die DIN 4108-Grundlagen
-
aktuell-geführtes NachweisVerfahren mit Beispiel (Quelle: TU Dresden)
>
http://www.ivk.tu-dresden.de/die_tu_dresden/fakultaeten/fakultaet_architektur/ibk/lehre/lehre_architekten/v_arch_downloads/vorl_1_2_downloads/V1_Arch_Raumluft.pps#1
- ein kompletter Nachweis mit Stand 2005
http://www.k-j-schmidt.de/joomla/images/stories/plaene/Waermeschutz2.pdf
 EnEV
- aktuelle TextFassung > s.
hier (Code) EnEV
- aktuelle TextFassung > s.
hier (Code)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
 FeuchteBilanz-Berechnungen nach DIN 4108-3
(zuvor: DIN 4108 Teil 5 Abschn. 11) FeuchteBilanz-Berechnungen nach DIN 4108-3
(zuvor: DIN 4108 Teil 5 Abschn. 11) |
|
|
|
|
|
|
|
 Nachweis der TauwasserFreiheit Nachweis der TauwasserFreiheit
> der Nachweis erfolgt über die Ermittlung der jährlichen FeuchteBilanz
> die FeuchteBilanz kann sein > positiv, ausgeglichen,
negativ (> hier kommt es zu einer, auf Zeit gesehen, DurchFeuchtung
des Bauteils)
> Berechnungen auf TauwasserFreiheit können erfolgen mit einem Durchschnittswert für das
gesamte Jahr bzw mit je einem geänderten Wert pro Monat
>
bei wechselnder Richtung des TemperaturGefälles wäre der Nachweis in
beide Richtungen zu führen
/damit ist nicht gemeint der jährliche Wechsel des DampfDruckGefälles
infolge des AussenKlimas
> ausführliche AblaufSchritte
dazu s. hier
-
es gibt einen Zusammenhang zwischen WärmeDämmung und
FeuchteBilanz
> je besser gedämmt ist, desto geringer wird das DampfdruckGefälle,
d.h. der FeuchteTransport und damit auch die Wahrscheinlichkeit von
Durchfeuchtungen
- Software zur Bemessung der
FeuchteBilanz mit den beiden
Glaser-Diagrammen ????
http://wasserdampfdiffusion.i-s-o.org/diffusi1.html
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
 SchallSchutz SchallSchutz |
|
|
|
|
|
|
|
- (gemeinhin) Klassifizierung im Bauwesen in
a) Lärm > dann
geht es um den Aussen-Bereich
> Nachweis nach DIN 18005
und
b) Schall
> dann geht es um den Gebäude-InnenBereich
> Nachweis nach DIN
4109
-
SchallArten
a) LuftSchall > Ausbreitung von
Schall in der Luft
und
b)
KörperSchall > Ausbreitung von Schall in BauwerksTeilen
c) Sonderform
TrittSchall > Schall, der beim Begehen als Körperschall
entsteht und als Luftschall abgegeben wird
- Bautechnischer Schallschutz
DIN 4109
> die DIN 4109 enthält lediglich öffentlich-rechtliche
Mindest-Anforderungen an den Schallschutz zur Vermeidung von
Gesundheitsgefahren
> Beiblatt 2 der DIN 4109 bringt
Vorschläge für einen erhöhten Schallschutz
- aktuell die einzelnen Teile der DIN 4109 s.
hier
-
Merkblatt zum Schallschutz nach DIN 4109
- Schallschutz für
erhöhten WohnKomfort > Richtlinie VDI 4100
> hier
sind bezüglich Wahrnehmung von Geräuschen aus Nachbarwohnungen drei
Schallschutzstufen (SSt) eingeteilt
> Bauherrschaften sollten nach den Kriterien des hierigen Tabellenwerkes
ihren Schallschutz auswählen
 Schall-Beeinflussungen
durch Schall-Beeinflussungen
durch
- MassivBau <-> "LeichtBauweise"
> massive Wände und Decken sind der beste SchallSchutz
> bei einer
HolzBauweise muss das gleiche Ergebnis idR mit
aufwendigen-schadensträchtigen Lsgen erreicht werden
>
Leichte Außenwände und Schallschutz
-
SchallschutzVerglasung
> wodurch unterscheidet sich SchallschutzVerglasung von normalen
Doppel-Verglasungen ?
a) der Scheibenabstand ist größer (100mm) um
Resonanz zu verhindern
oder
b) Verwendung unterschiedlich dicker/steifer Einzelscheiben
- Gebäude-Trennwand bei
DoppelHausHälften (DHH) ein-schalig <->
zwei-schalig
- SchwingungsVerhalten von HolzbalkenDecken > Luft- und
Tritt-Schallschutz
> Anforderungen an den
Schallschutz bei einer Holzbalkendecke
-
VorsatzSchalen / Zweischaligkeit nach dem Prinzip biege-steif <->
biege-weich
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 SchallschutzNachweis
WGH
Mütze
SchallschutzNachweis
WGH
Mütze |
|
|
|
|
|
|
|
- der SchallschutzNachweis erfolgte auf Basis der DIN 4109, also den
MindestAnforderungen an den bauseitigen Schallschutz
- es
handelt sich um ein BestandsGebäude, wo die schallschutz-seitige
Beurteilung einzelner BauwerksTeile erst nach Freilegung der
vorhandenen Bauteile und dann darauf folgenden planungs-seitigen
Festlegungen zum NeuAufbau möglich ist
- regelmässig
schallschutz-seitig besonders kritische Bauteile sind die TreppenAnlagen
Sie sind meist massiv ausgeführt und irgendwie in die begrenzenden
WohnungsTrennwände eingebunden, was zu hoher SchallÜbertragung führt.
- hier sollte dann ein SchallschutzGutachten mit
SchallpegelMessungen vor Ort beauftragt werden, als Grundlage für die
BauSanierungs-Planungen
- unsre Lsg in Verbindung mit der TH-Anlage
bei diesem Objekt: durch GrundrissVeränderung wurden Küchen + Bäder an
den Bereich der TH-Wände gelegt
|
|
|
|
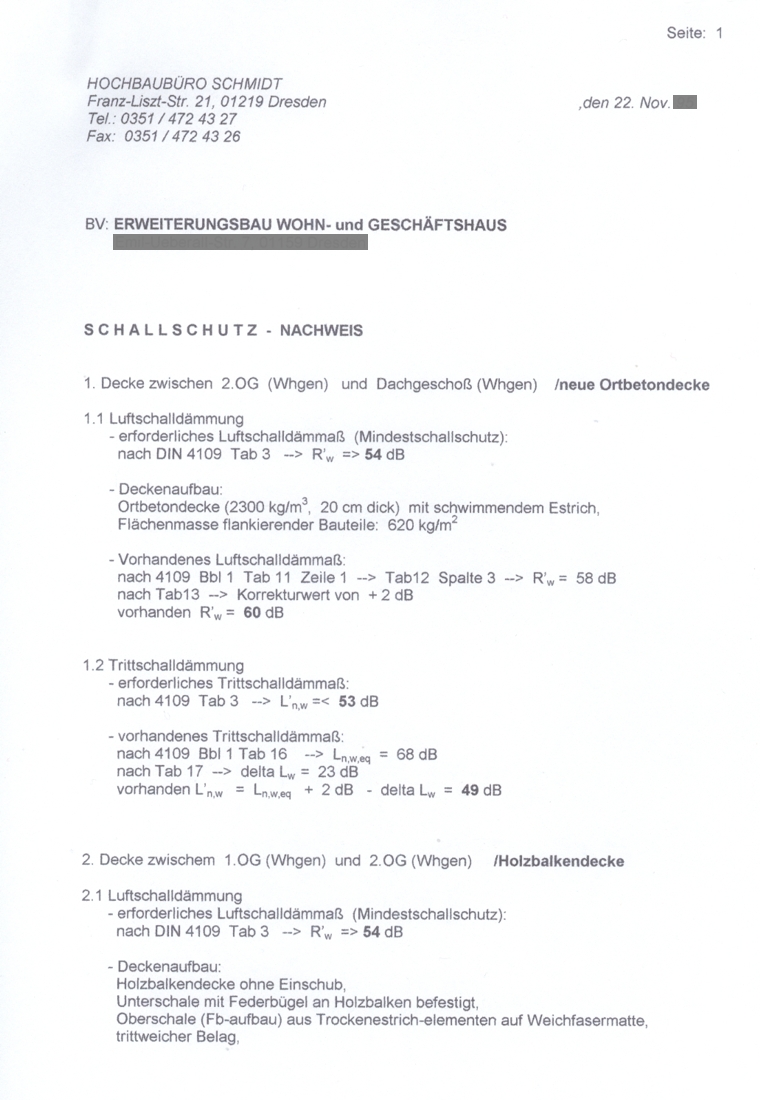 |
|
|
|
|
|
|
|
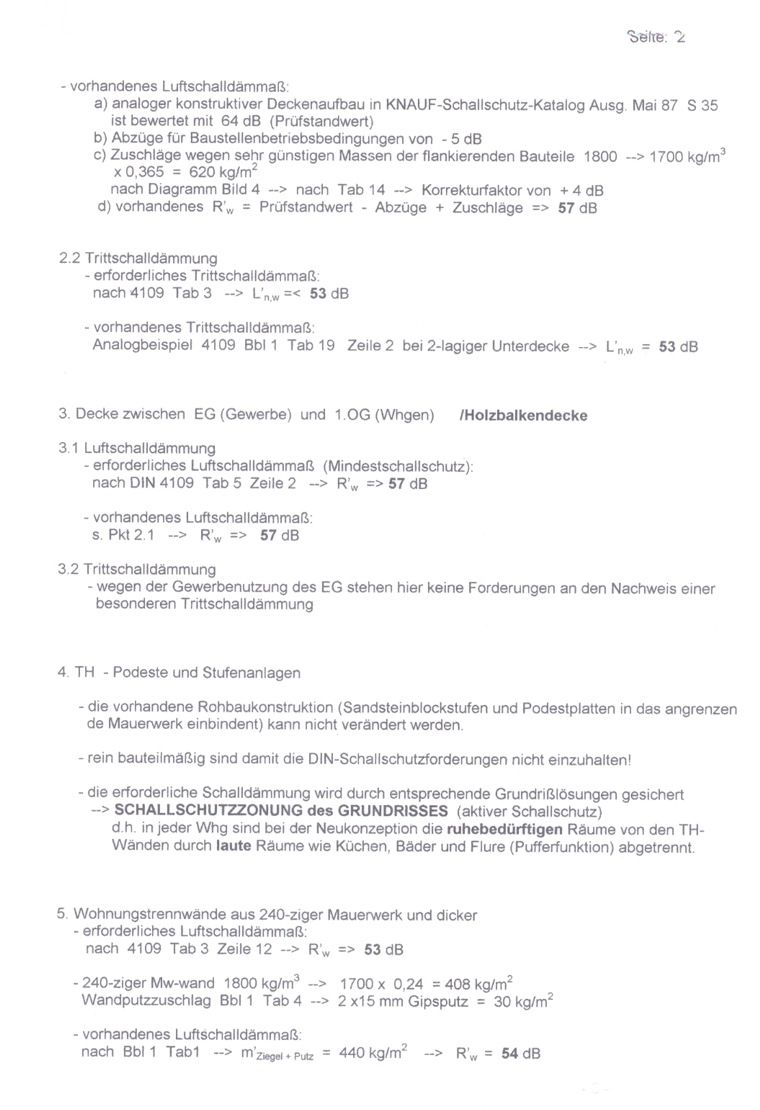 |
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
 weitere
Schutz-Bereiche am Bau weitere
Schutz-Bereiche am Bau |
|
|
|
|
|
|
|
 BlitzSchutz
BlitzSchutz |
|
|
|
|
|
|
|
- BO § 46 Blitzschutzanlagen > regelt das Erfordernis
bauseitiger BlitzschutzMassnahmen
> hier steht nur der lapidare
Satz;
Bauliche Anlagen, bei denen nach Lage,
Bauart oder Nutzung Blitzschlag leicht eintreten oder zu schweren Folgen
führen kann, sind mit dauernd wirksamen Blitzschutzanlagen zu versehen.
> gemeinhin lässt sich das wie
folgt interpretieren bzw danach sind BlitzSchutzMassnahmen
erforderlich wenn folgende Sachverhalte vorkommen;
1. HochHäuser
2. exponent (BergKuppen) einzeln stehende Gebäude
3. Gebäude mit weicher Bedachung = leicht brennbare DachDeckungen
4. GebäudeNutzung als Lager für explosive Stoffe
5. Gebäude für grössere
MenschenAnsammlungen
- ein gebäude-seitiges
BlitzschutzSystem besteht aus
1. FangEinrichtungen
2. Ableitungen
3. Erdung
> dieses
gebäude-seitige BlitzschutzSystem wird gemeinhin
als äusserer Blitzschutz bezeichnet
-
BlitzschutzMassnahmen im Gebäude-InnenBereich obliegen der
Elektro-Fachplanung /dem AN-ElektroArbeiten
> der
innere Blitzschutz umfasst den Potenzialausgleich und den
Überspannungsschutz
> dafür würde dann zumindest eine Erdung
erforderlich
- BlitzschutzMassnahmen nach DIN 57185 /VDE
0185
- wirksame BlitzschutzMassnahmen dienen dem vorbeugenden
Brandschutz BO § 17 (1)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
 Flächen-
und Volumen-Berechnungen
am Bau Flächen-
und Volumen-Berechnungen
am Bau |
|
|
|
|
|
|
|
 Flächen- und Volumen-Berechnungen nach DIN 277
Flächen- und Volumen-Berechnungen nach DIN 277 |
|
|
|
|
|
|
|
 DIN 277
DIN 277
> gibt vor wie Flächen und RaumInhalte von unterschiedlichsten Bauwerken zu
berechnen sind
>
Bauteil-Volumen sind danach entsprechend ihrer Nutzung mit unterschiedlichen
Anteilen zu rechnen (zu 100%, zu einem Drittel, gar nicht)
> weiterhin gibt es Überschneidungen
zu anderen RechenVorschriften zB das anrechenbare RaumVolumen im
SteilDach-Bereich nach DIN 277, II. BV, LBO liefert 3
verschiedene Ergebnisse
> DIN 277 ist quasi eine Wissenschaft für sich, wenn man noch die Änderungen
im-Laufe-der-Zeit mit einbezieht
> diese Sachverhalte sollte man bei
KennzahlVergleichen im HinterKopf haben um ggf die
EntstehungsGrundlagen zu hinterfragen /zu berücksichtigen
- ausführlich zur
DIN 277
> Teil 1 - aktuelle Ausgabe: 2.2005
- DIN 277
http://messdat.de/310-DIN277.pdf > hier sind alle 3 Teile erläutert
 begriffliche Flächen-Klassifizierungen > BGF BRI
NGF KGF etc
begriffliche Flächen-Klassifizierungen > BGF BRI
NGF KGF etc
>
Abkürzungsverzeichnis zu den Begriffen der DIN 277
-
der frühere Begriff GrundrissFläche wurde in
GrundFläche geändert
- umbauter Raum (Fassung 1950)
< ist nicht identisch mit > BRI (Fassungen ab 1976)
 DefinitionsBlätter "MeßRegeln" (analog VOB im Bild) zur exakten
Klärung was zu berechnen ist, gibt es für
DefinitionsBlätter "MeßRegeln" (analog VOB im Bild) zur exakten
Klärung was zu berechnen ist, gibt es für
> AWF AussenWand-Flächen
> IWF InnenWand-Flächen
> BAF Basis-Flächen
> HTF
Horizontale TrennFlächen
> DAF Dach-Flächen
- für Volumen-Berechnungen (BRI) gibt es unterschiedliche Verfahren
> für einen DachBereich kann nach 3 verschiedenen MessRegeln das offizielle
Volumen ermittelt werden:
a) LBO
b) DIN 277
c) 2.BV /WoFlV
 KostenKennwerte s. bei mir
hier
KostenKennwerte s. bei mir
hier
>
m² / m³-Kennzahlen-Vorgaben für FlächenGrössen auf grundlage DIN 277
|
|
|
|
|
|
|
|
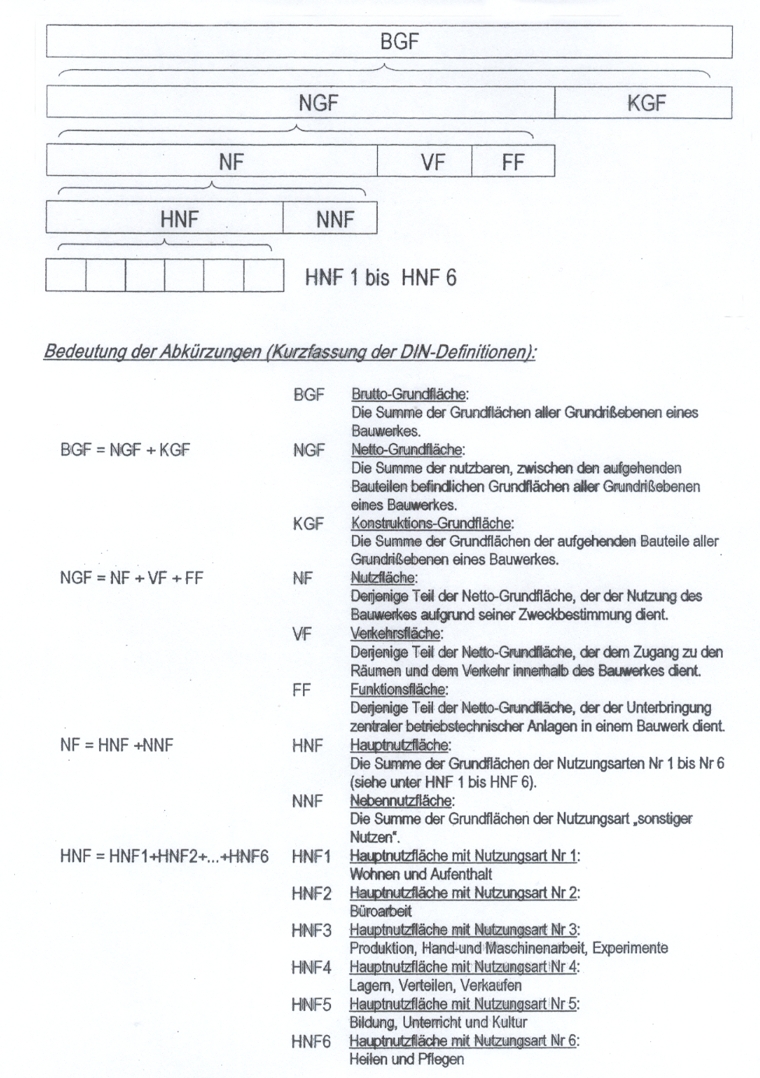
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 Beispiel-Auszug zu Messregeln für VolumenBerechnungen
(Wiedergabe einer LehrgangsUnterlage)
Beispiel-Auszug zu Messregeln für VolumenBerechnungen
(Wiedergabe einer LehrgangsUnterlage)
- Volumina beim oberen GebäudeAbschluss
>
blau-farbig ist zu einem Drittel anzurechnen
> rot-farbig ist zu 100%
anzurechnen
> das Beispiel dient
nur der Verdeutlichung des Sachverhaltes; die Aktualität im Detail ist
nicht gerantiert (> umbauter Raum ist ein alter Begriff)
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2019-02-23
DIN277 Ausgabe-2016
Mit Brutto-Grundfläche (BGF) bezeichnet man
diejenige Fläche, welche sich aus der Summe
aller
Grundflächen
+
zwar
aller
Grundrissebenen eines Gebäudes
errechnet.
Sie ist geschossweise zu ermitteln.
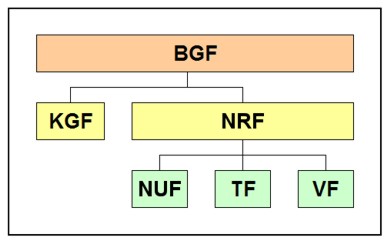
was ist BGF nach DIN277 > BruttoGrundFläche
also alle Geschosse saldiert
GF nach BauNVO > GeschossFläche
Nach der 2016 neu erschienenen DIN 277 wird nur noch zwischen dem
Regelfall (R)
und dem Sonderfall (S)
für die Ermittlung der Brutto-Grundfläche unterschieden.
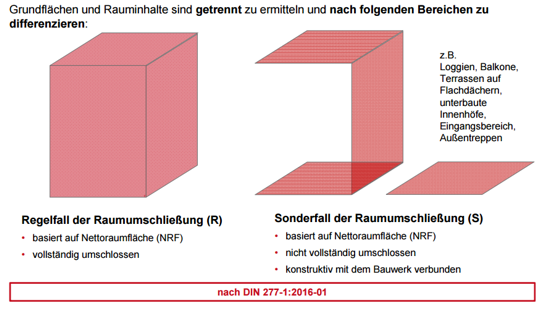
Somit umfasst die BGF im Gegensatz zur Geschossfläche (GF) gemäß
BauNVO sämtliche Geschosse eines Gebäudes einschließlich nicht als
Vollgeschosse geltender Dachgeschosse und der unterirdischen Flächen
(Kellerräume, Tiefgaragen etc.).

KennZahlen TK-LagerKomplex
GF
(GrundFläche) habe ich eigentlich hier falsch verwendet
/ich muß mit DIN277 -gerechten Flächen-Bezeichnungen agieren und das
wäre dann NRF (Netto-RaumFläche)
TIKO (Tiefkühl-LagerKomplex) ............................. 3.640m² NettoFläche
TechnikBereich (KälteErzeugung +
HausTechnik) ... 1.914m² NettoFläche
/ 957m² NettoFläche pro Geschoß
CoolDock (ExpeditionsBereich) ............................
1.003m² NettoFläche
KühlLager .......................................................
886m² NettoFläche
Sozial-Bereiche ...............................................
1.005m² NettoFläche / 335m² NettoFläche pro Geschoß
Umgänge (Bereiche zw TIKO und AW) ...................
188m² NettoFläche
NRF
gesamt ........................................... .....
8.636m² NettoFläche
be-baute Fläche < > über-baute
Fläche > also
alles nur 1x gerechnet
>>> 8.636 - (1x
957m²) - (2x 335m²) = 7.009m² + KF (= 280m²) = 7.289
> 7.300m² bebaute Fläche
/ KF = 4% von NRF
Summe-der-Netto-Flächen > 4% von 7.009m² = 280m²
/ die 4%
sind eine rein empirische Annahme von mir, nachdem ich fiktiv den Grundriß
"abgefahren" bin
BGF (Brutto-Grundfläche) nach DIN277
Ausgabe-2016
>>> NRF /8.636m² + KF / (4% von 8.636m² =) 345m² = 8.981m²
> ca 9.000m²
> das bedeutet die Wände im TechnikBereich wurden 2x und im
SozialBereich 3x erfaßt
letztlich sind es die
gleichen Wände, nur im nächst-höheren Geschoss
BRI (BruttoRaumInhalt)
Höhe
TIKO (Tiefkühl-LagerKomplex) ............
.....13,20.m
Höhe CoolDock (ExpeditionsBereich) ....................7,20.m
für den GesamtBaukörper
mit SozialBereich ..... 121.000m³
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 Berechnung nach II. BV /
Wohnflächenverordnung (WoFlV)
Berechnung nach II. BV /
Wohnflächenverordnung (WoFlV) |
|
|
|
|
|
|
|
- die
II. BV enthielt bis zum 31. Dezember 2003 in den §§ 42bis44 auch
Regelungen für die Berechnung von WohnFlächen.
Seit dem 1. Januar 2004 gilt hier die Wohnflächenverordnung.
Werte, die bis zum 31. Dezember 2003 aufgrund der II. BV berechnet wurden,
bleiben jedoch weiterhin gültig.
- DIN 283 (war ein sinngemäßer Vorläufer der II.BV)
>
die ursprünglichen Teile der DIN 283 bestanden aus dem Teil 1: Begriffe
(Ausgabe März 1951) und dem Teil 2: Berechnung der Wohnfläche und Nutzfläche
(Ausgabe Februar 1962)
> der Teil 1 wurde im August 1989 zurückgezogen.
> der Teil 2 wurde im Oktober 1983 zurückgezogen und durch die DIN
277, Teil 1 sowie die II. Berechnungsverordnung ersetzt.
-
Wohnflächenverordnung (WoFlV)
> gilt für den
preisgebundenen (sozialen) WhgsBau
>
Kommentierung einzelner Abschnitte
> da die Wohnflächenverordnung für den preisfreien Wohnraum nicht
bindend ist, hat der Vermieter die Möglichkeit der Wahl zwischen der
Berechnungsmethodik nach DIN 277 und Wohnflächenverordnung (WoFlV)
-
DIN 277 gilt für WohnFlächen-Berechnungen wenn WoFlV
nicht zur Anwendung kommt
-
Gegenüberstellung der Unterschiede bei der Berechnung der Wohnfläche von
II.BV WoFlV DIN 277
- Anrechenbare Grundfläche
nach
WoFlV: zur Ermittlung der Wohnfläche sind anzurechnen:
> die Grundflächen von Räumen und Raumteilen mit einer lichten Höhe
von mindestens 2 m > zu 100%
> von Räumen und Raumteilen mit einer lichten Höhe von mindestens
1 m und weniger als 2 m > zu 50%
> von Wintergärten, Schwimmbädern und ähnlichen, nach allen
Seiten geschlossenen Räumen > zu 50%
> von Räumen und Raumteilen mit einer lichten Höhe von weniger als
1 m > zu 0%
> von Balkonen, Loggien und Dachgärten oder gedeckten Freisitzen,
wenn sie ausschl. zu dem Wohnraum gehören > zu max. 50%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
 Statische
Berechnungen Statische
Berechnungen |
|
|
|
|
|
|
|
 Statische Berechnung
Statische Berechnung
 BewehrungsZeichnungen
BewehrungsZeichnungen
- das Lesen einer BewehrungsZchng
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|



|
|


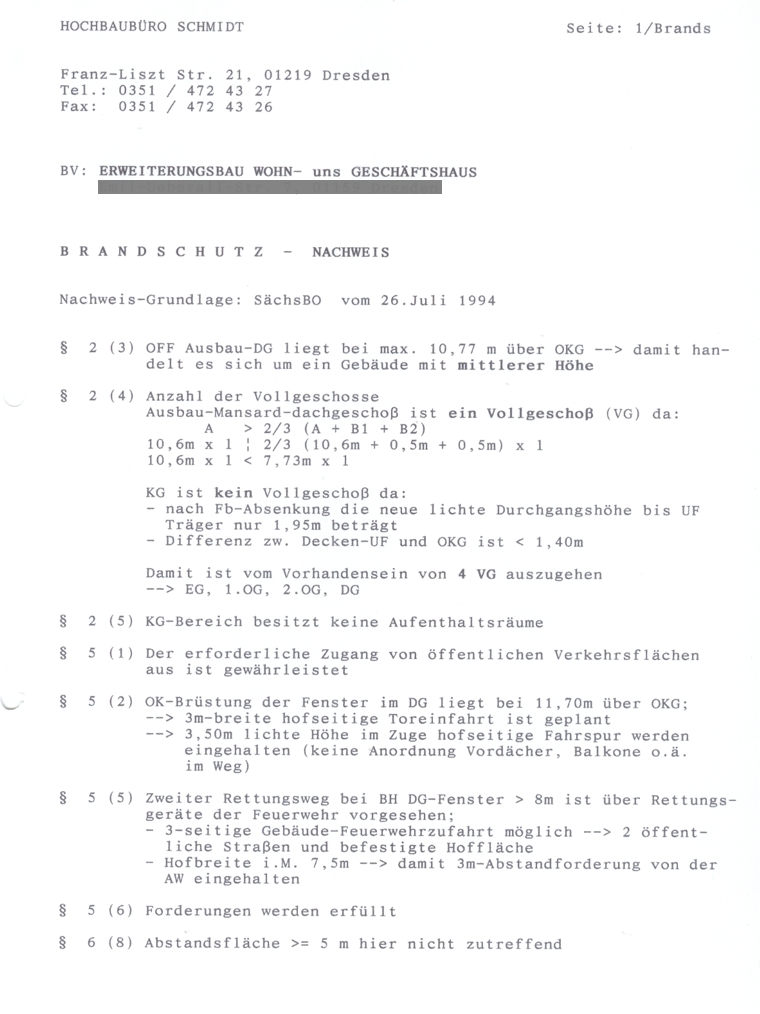
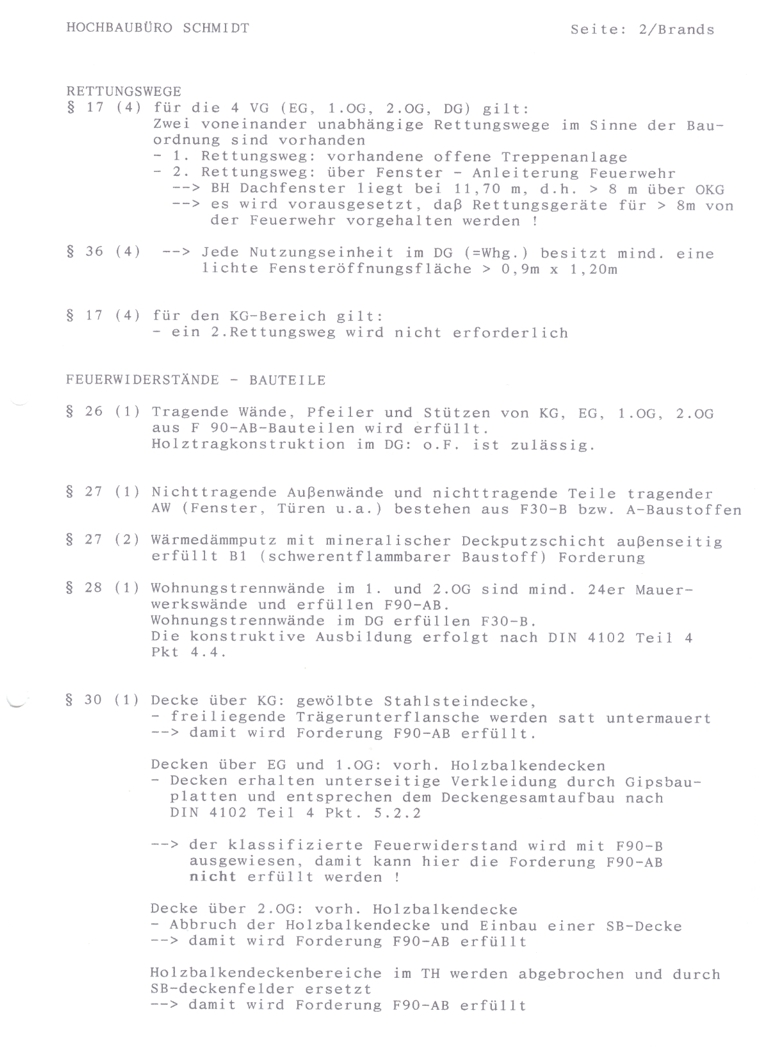
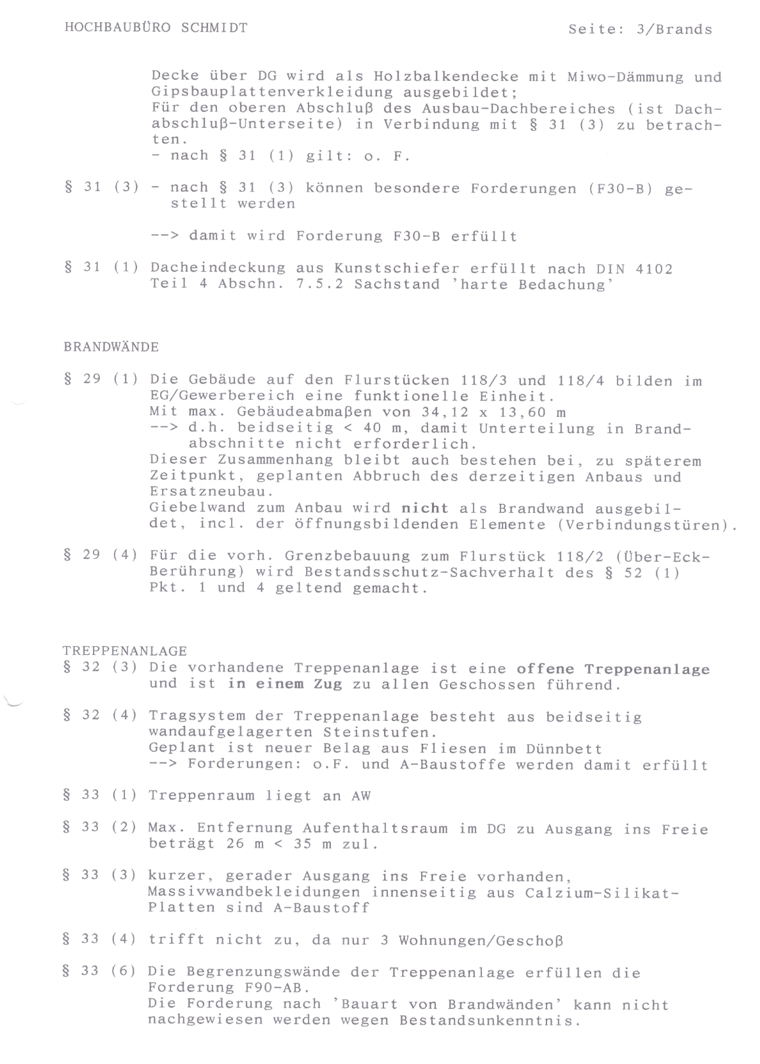
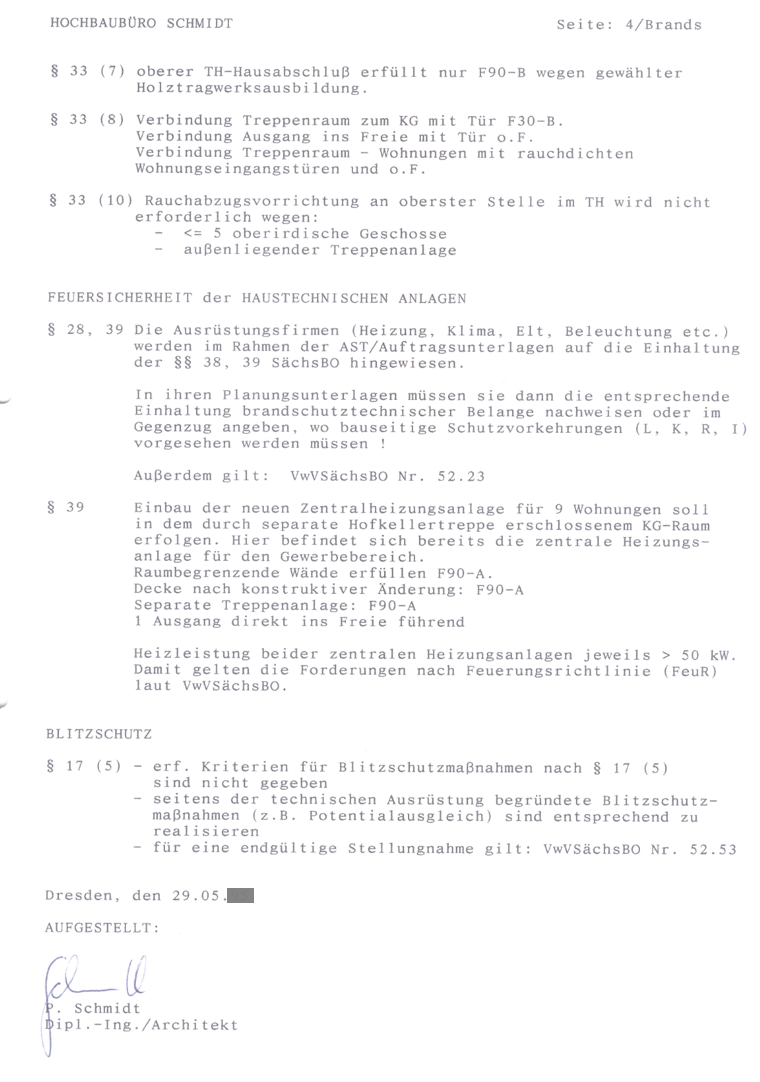
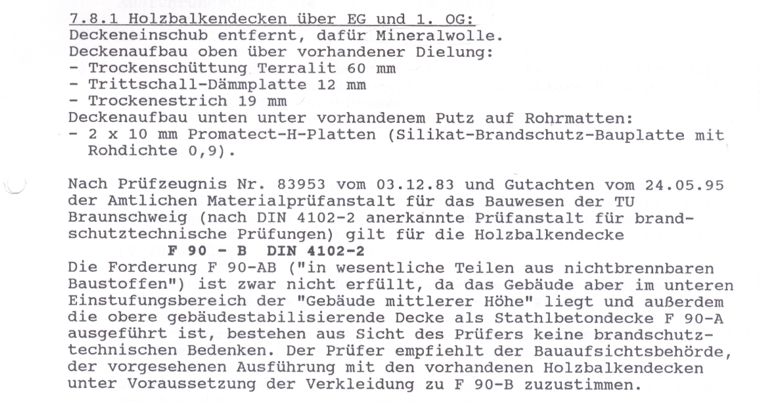
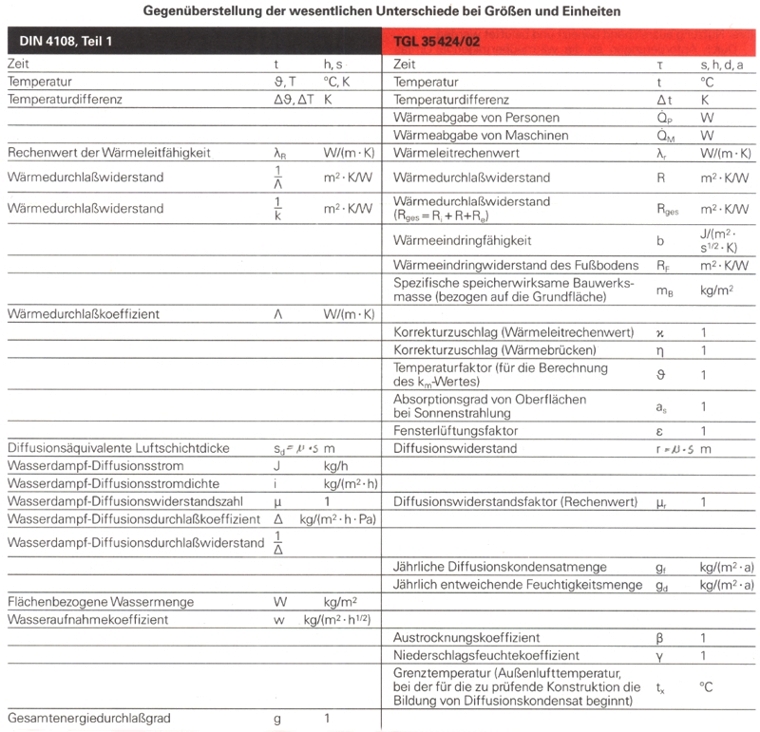
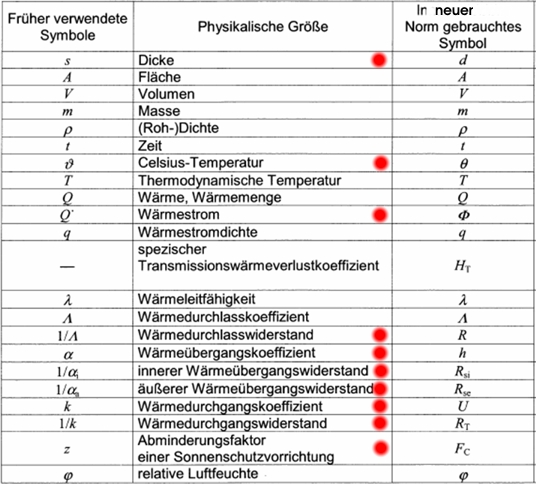 )
)